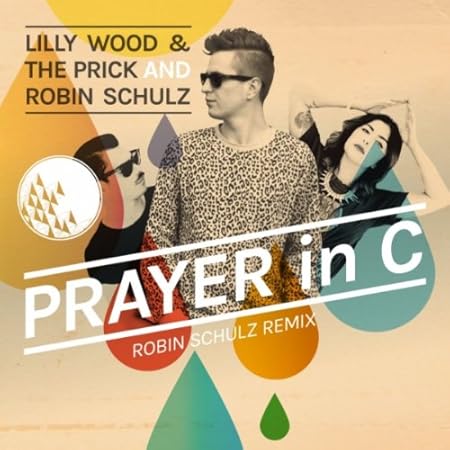OneRepublic ist eine Band, mit der hab ich schon so meine Probleme. Das hängt vielleicht mit der allgemeinen Glaubwürdigkeitskrise von PopRock und Alternative zusammen. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass die Überpräsenz im Mainstream eben auch eine völlige Belanglosigkeit erzeugt und gar nichts mehr in irgendeiner Art Bedeutung hat. Vielleicht nehme ich dieses ganze Musikbusiness auch einfach nur zu ernst. Denn irgendwie bin ich hier ja immer auf der Suche nach einem Zusammenhang zwischen Kulturprodukt und Lebensalltag. Dass Menschen einfach alles was sie tun und konsumieren egal ist, kann ich nicht glauben.
OneRepublic und deren Leadsänger Ryan Tedder also waren bei dieser Auseinandersetzung regelmäßig Anstoß zu neuen Überlegungen. Eingängig bis zum Abwinken, damit erfolgreich hoch und runter, gleichzeitig aber völlig bedeutungslos weil fast immer in einer unglaublichen Beliebigkeit alles zusammenschmeißend, was ihnen nur zwischen die Finger kam. Nun kommt die Lead-Single zur Deluxe-Wiederveröffentlichung ihres Albums Native und wunderbar lässt sich wieder alles das bescheinigen, was bereits bei den vorhergehenden Hits zu kritisieren war.
Seltsamerweise geht mir Love Runs Out aber dann doch nicht schon beim dritten Mal völlig auf die Nerven vor lauter Allerweltsbreiigkeit, sondern es setzt sich fest und fängt mir an zu gefallen. Was ist denn da los? Hat der Song tatsächlich eine andere Qualität? Etwas, das ich seit Apologize nicht mehr finden konnte.
Vielleicht ist es die Ähnlichkeit zu schon Vorhandenem, die dem Titel in einigen Foren bescheinigt wird. Von Kanye West bis Adele reichen offenbar die Referenzen. Haben sich also Ryan Tedder und seine Jungs einfach sehr sehr clever altbewährter Rezepte bedient, ein paar Melodienschnipsel neu zusammen gefügt und so unserer Wahrnehmung ein Schnippchen geschlagen: Kenn ich – gefällt mir?
Kanye West “Love Lockdown” und Adele “Rumour Has It”
Die Ähnlichkeiten sind wahrhaftig nicht abzustreiten, aber OneRepublic beschränken sich nicht einfach auf ein hübsches MashUp, sie fügen der Rhythmusorientierung, die beide Vorlagen besitzen, noch etwas hinzu: Ein zwingend einnehmendes und über den kompletten Song wiederholtes Piano-Riff. Das verleiht dem Titel einen Sog und eine Funkyness, die ich in dieser Art bei einer OneRepublic-Single noch nicht entdeckt habe. Und die auch gleich noch eine neue Referenz eröffnet. Denn bereits bei der ersten Begegnung mit Love Runs Out stellt sich ein Dèja vu-Effekt ein: Diese Art, einen Song zu beginnen, zelebrierte Ende der 90er bereits Moby mit seiner Single Honey.
Auch wenn die beiden Songs ansonsten nichts weiter gemein haben, so finde ich hier doch ein paar hübsche (wahrscheinlich sehr zufällige) Parallelen. Moby nämlich spielte mit dem Album Play, von welchem Honey stammt, recht ausführlich durch, was es bedeutet seine elektronisch-melancholische Handschrift mit Anleihen aus dem Funk zu versehen. Nach 10 Jahren im Musikbusiness erfand er sich so quasi noch einmal ganz neu. Ähnlich tat das in dieser Zeit auch noch einmal Fatboy Slim/Norman Cook, obwohl der in den 10 bis 15 Jahren seiner bis dahin gehabten Musikkarriere schon häufiger sein musikalisches Repertoire grundlegend durchgerüttelt hatte.
OneRepublic haben nunmehr auch 10 Jahre Erfahrung in der Tasche und mir scheint, dass sie mit Love Runs Out tatsächlich einen für sie neuen – oder sagen wir: ungewohnten Weg einschlagen. Wohin dieser sie führt und ob sie überhaupt gewillt sind, hier weiter auszuprobieren, das darf getrost mit großen Fragezeichen versehen werden. Denn noch sieht alles eher aus wie nichts weiter als ein derzeit modischer Rückgriff auf die Endneunziger. Dieser Eindruck wird gestärkt durch das fukminante Video, welches sie zu Love Runs Out liefern.
Das sind Pop-Video-Bilder wie sie Großraum-Acts ganz gern mal benutzen: Überwältigend bunt, auch pathetisch und bedeutungsschwanger. Besser hätte es David Lynch in den 90ern auch nicht hingekriegt. Höchstens, dass seine Düsterkeit noch um einiges mystischer und verrätselter war. Bei OneRepublic drängen sich die Fragen nach Bedeutung jetzt weniger auf. Ich verstehe zwar die historischen und Ethno-Bezüge überhaupt nicht: Warum bitte muss der Drummer in so einem ägyptophilen Outfit da sitzen? Und was sollen die ekstatisch tanzenden Frauen mit Bändern im Haar? – Aber das will im Jahr 2014 ja im Grunde kaum jemand wirklich wissen: Ägypten ist seit Katy Perry’s Dark Horse mehr als salonfähig und musikalisch-tänzerische Ekstase gehören quasi zum Repertoire des Post-Techno-Pops. Allemal ist es sehr schön anzusehen. Den meisten Musikkonsumierenden reicht das.
Im Fall von Love Runs Out hat das Bild aber tatsächlich auch etwas mit dem Songinhalt zu tun. Ryan Tedder beschreibt hier manisch-expressive Gefühlssituationen: Extase und Hingabe bis zum bitteren Ende, Genuß und Selbstvergessenheit ohne Kompromiss. Diese Wildheit in ethno-inspirierte Konstellationen zu stecken bedeutet gleichzeitig eine Kritik an unserer vorherrschenden Kultur. Offenbar ist in der westlich geprägten Konsumwelt nicht viel Platz für wilde und unbändige Emotionen. Und erst recht nicht für Menschen, die sich diese zu eigen machen. Das geht maximal in abgeschlossenen Settings oder eben in Kulturen, die Nordamerikanern und Westeuropäern als ritualgeprägt und irgendwie wild erscheinen. (Dass alles das auch ein sehr sehr schwieriges Unterfangen ist, das wäre einen eigenen Artikel wert.)
An dieser Stelle könnte ich Schluss machen und OneRepublic einen großen Wurf bescheinigen: Subtile Gesellschaftskritik mit einem Popsong. Allein, die bisherigen Erfahrungen mit der Band lassen mich zweifeln und zögern, diesen Schritt zu tun. Die Verhältnisse zu kritisieren und sich gleichzeitig affirmativ-anbiedernd im System zu inszenieren find ich einen sehr waghalsigen Ansatz. Jaja – ich höre das häufiger: Wir kämpfen nicht mehr gegen das System, wir verändern/zerstören es von innen heraus. Hoffentlich ist das System an dieser Stelle nicht klüger und schneller.
Im Fall von OneRepublic hat es zumindest schonmal nicht funktioniert. Love Runs Out wurde vom ZDF eingekauft um die Berichterstattung zur Fußball-WM in Brasilien musikalisch aufzupeppen. Von dem Song, seiner Kraft und seinem möglichen Potenzial bleibt in den Minuten-Einspielern nicht sehr viel übrig. Allemal ist es aber immer noch besser als der unsägliche Einsatz von Andreas Bourani’s Auf uns. Das kriegt nämlich in der steten Wiederholung einen ganz unangenehm nationalistischen Dreh.